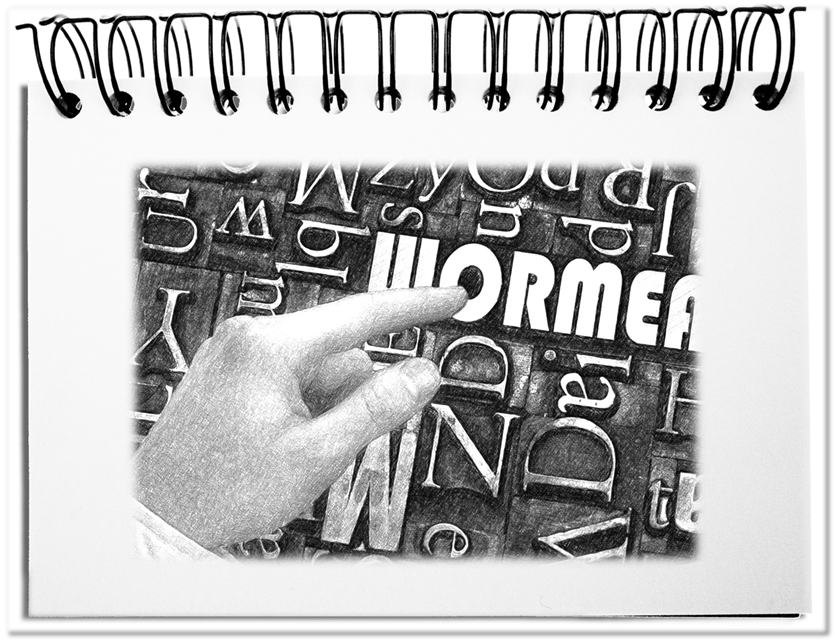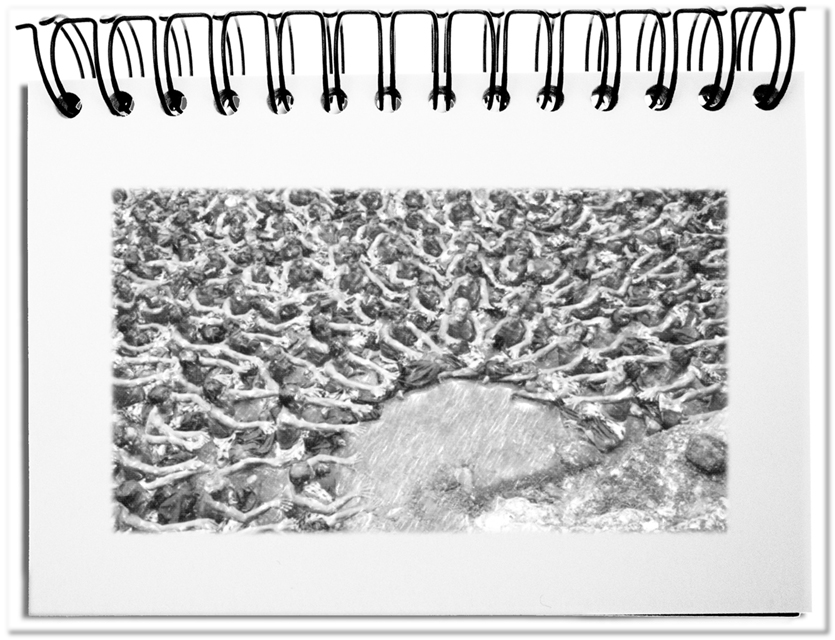Bedeutung entsteht schon immer durch die bewusste Verarbeitung von Wörtern, die jemand verbreitet. Die Reichweite war früher beschränkt auf Personen, die sich in unmittelbarer Nähe befanden. Dadurch umgaben Inhalte auch immer ein nachvollziehbarer kultureller, sprachlicher und sozialer Kontext, der das Verständnis leichter machte. Mit den Massenmedien wurden über Jahrhunderte Wörter von fachkundigen Publizisten einem ständig wachsendem Publikum bereitgestellt – via Presse, Radio und TV. Dies führte zu einer einheitlichen Sprache und einem Pressekodex, der der Wahrheit, Zuverlässigkeit und Menschenwürde verpflichtet ist. Gleichzeitig entwickelte sich die Kunst, Inhalte verdreht zu interpretieren, um dadurch die Meinungsbildung des Publikums zu beeinflussen.
Durch das Internet ist es jetzt wieder möglich Gedanken direkt von Einem zum Anderen ohne sachverständige Vermittler auszutauschen – allerdings beschränkt auf die genutzten Wörter, die ohne zusätzliche Kontexthinweise sowie ohne Anhaltspunkte auf vorsätzliche Beeinflussung verinnerlicht werden. Als Empfänger von Unmengen an Nachrichten gehen wir davon aus, dass diese Botschaften genau das bedeuten, was wir darunter verstehen.
Grundlage ist der Trugschluss zu denken, dass Sätze und Wörter etwas Eindeutiges bedeuten. Vielleicht sollte man sich die Eigenschaften von Aussagen bewusst machen. In diesem Beitrag geht es nur um geschriebene und gesprochene Sprache – nicht um bildliche Darstellungen. Einfachheitshalber sprechen wir dabei vom Sprecher und vom Zuhörer, was auch den Schreiber und Leser einschließt.
- Eine Ansammlung von Wörtern
Sprache liefert eine Reihe von Wörtern, die, mehr oder weniger, den grammatischen Regeln folgen. Der Sprecher wählt die Ausdrücke aus seinem Wortschatz, mit etwas Glück orientiert an seiner Zielgruppe – die passende Landessprache und einen angemessenen Jargon. Das Publikum empfängt die Wörter und versteht den Sinngehalt durch das eigene Sprachvermögen. Die allgemeine Annahme ist, dass es dabei zu einer weitreichenden Überlappung der Bedeutung kommt, was sehr wahrscheinlich nicht so ist. - Eine Vielzahl von Absichten
Jede Aussage umfasst immer mehrere Absichten: 1) Sagen, was ist; 2) Auffordern, etwas (nicht) zu tun; 3) Offenlegen, etwas (nicht) zu tun; 4) Mitteilen, wie es einem geht; 5) Bekannt geben, was gilt. All das findet sich in einem Satz und wird je nach dem Interesse der Zuhörer bemerkt. Die folgende Äußerung ist wahllos aus dem Strom von Nachrichten gezogen: A spricht B zwei Dinge ab: Erfahrung und Charisma. Was beinhaltet das: 1) B fehlt Erfahrung und Charisma. 2) B ist nicht annehmbar. 3) A nimmt B nicht an. 4) A fühlt sich nicht gut mit B. 5) B wird es nicht werden. Durchsuchen Sie selbst einen beliebigen Satz nach den enthaltenen Botschaften. - Ungeschickte Wortwahl
Eine Aussage lässt sich mit unterschiedlichen Wörtern machen. Und manchmal vergreift man sich im Wording. Beispiel ist die Aussage „Das Soziale mit dem Nationalen versöhnen“. Trotz der geänderten Reihenfolge wird einem der doppelte Sinn bewusst. Bei der Menge anderer Wörter, die man hätte nutzen können, drängt sich die Frage auf, inwieweit das absichtlich oder unabsichtlich geschehen ist. - Wer weiß schon, was eigentlich gemeint ist
Die Botschaft hinter den Wörtern wird auch mit bewusster Wortwahl nicht immer klar. Eine Aussage kann so gemeint sein, wie sie gesagt wird. Es kann jedoch auch etwas zum Ausdruck gebracht werden, ohne es zu meinen. Schnell wird etwas ausgedrückt, was anders gemeint ist. Besonders frustrierend ist es, wenn man etwas sagt und niemand versteht, was man im Sinne hat. Aus diesen Gründen ist ein offener, wechselseitiger Diskurs mit Fragen und Antworten immer einer einseitigen Proklamation vorzuziehen.
Fazit: Es ist zu befürchten, dass es keine gemeinsame Grundlage mehr gibt, um allseits akzeptierte Tatsachen auszudrücken. Die eigentliche Bedeutung steckt im Auge des Betrachters und seiner opportunistischen eigenen Auslegung. Obwohl der Sprecher meint, dies steuern zu können, sind es die Zuhörer, die den Gehalt und die Absicht einer Aussage verarbeiten. Heute haben alle, die Zugang zum Internet haben, einfache Möglichkeiten zu veröffentlichen. Dies verschärft die Situation, dass Meinungen in die Welt kommen, die es verdienen alternative Fakten genannt zu werden. Der Hintergrund ist unbekannt und die Inhalte werden unkritisch übernommen. Die Faktenchecker helfen an der Stelle nicht. Es handelt sich bei dem direkten Austausch im Internet um eine neue Form des Gesprächs, in dem Meinungen ausgetauscht werden. Im Interesse der Meinungsfreiheit muss dies erlaubt sein, auch wenn die Inhalte ohne Verzögerung weltweit verfügbar sind und gleichzeitig Unmengen an Menschen direkt erreichen. Wir müssen lernen, zwischen den Äußerungen Einzelner und fachkundigen Veröffentlichungen zu unterscheiden, wie im alltäglichen Gespräch auf der Straße – auch wenn die Unterschiede nur schwer erkennbar sind. Es lohnt sich ein Blick in das Impressum der Publizisten. Dort wird ein Teil des Kontextes sichtbar oder verschleiert und man erkennt, mit wem man es zu tun hat oder eben nicht. Fehlen das Impressum, die Namen der Autoren, die Anschrift und die Telefonnummer, oder ist die Kontaktanschrift eine Freemail, oder liegen die Zuständigkeiten im Ausland, sind die Inhalte bedenklich. In jedem Fall gilt, dass es einfach keine Bedeutung aus sich heraus gibt.